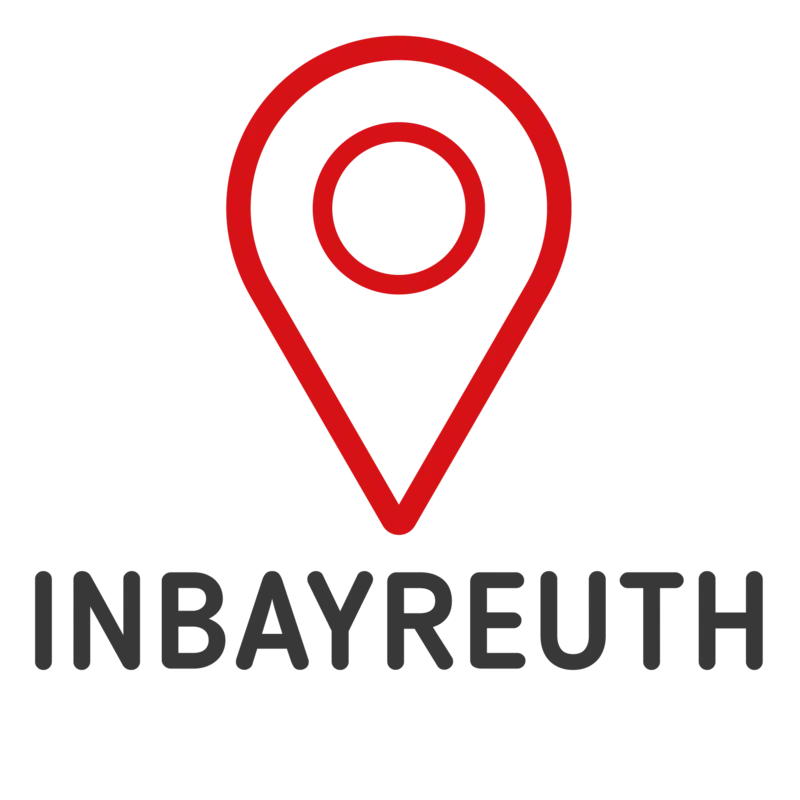Park & Ride: Hoffnungsträger oder halbe Lösung?
BAYREUTH. Am 26. Februar 2025 hat der Bayreuther Stadtrat erstmals einen Nahverkehrsplan beschlossen. Gemeinsam mit dem Landkreis verfolgt die Kommune damit das Ziel, den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) umfassend zu verbessern – auch über die Stadtgrenzen hinaus. Unter dem Leitmotiv „Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern und Verkehr verträglicher gestalten“ sollen neue Maßnahmen dazu beitragen, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, ohne dabei die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger einzuschränken.
Ein zentraler Bestandteil des Plans ist die mögliche Einführung von Park-&-Ride-(P+R)-Anlagen. Diese sollen insbesondere Pendler aus dem Umland dazu bewegen, auf Bus und Bahn umzusteigen. Ohne Bahnanschluss bleibt das Konzept oft ineffektiv.
Der Anstoß für diesen Prozess kommt von einem Antrag der SPD-Stadträte Dr. Andreas Zippel und Thomas Bauske. Sie fordern, dass Stadtverwaltung, Landratsamt, die Gemeinden des Umlands sowie die Stadtwerke gemeinsam geeignete Flächen identifizieren und prüfen, wie diese langfristig für P+R gesichert werden können – etwa durch Kauf, Festschreibung im Bebauungsplan oder über Dienstbarkeiten.
Im Nahverkehrsplan ist vorgesehen, verschiedene Formen von Pendlerverkehr differenziert zu betrachten: Wer über die Autobahn nach Bayreuth fährt, soll am Stadtrand Parkmöglichkeiten finden. Für Pendler aus den angrenzenden Gemeinden hingegen könnten P+R-Flächen direkt im Umland sinnvoller sein – verbunden mit einer regelmäßigen Anbindung im 30-Minuten-Takt.
Neben geeigneten Flächen bedarf es auch funktionierender Strukturen: Die P+R-Angebote müssen mit den Arbeitsplätzen und anderen Zielorten sinnvoll vernetzt sein und den planungsrechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen. Der Prozess erfordert eine enge Abstimmung zwischen Stadt, Landkreis, Gemeinden, Stadtwerken und Verkehrsunternehmen. Neben Parkplätzen am Stadtrand sollte das Konzept such Park+Rail Stellflächen vorsehen.
Doch das Konzept ist nicht ohne Schwächen. Eine Untersuchung des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2018 legt nahe, dass P+R-Anlagen in ihrer heutigen Form das Ziel der Verkehrsreduktion oft verfehlen. Zwar parken Autofahrer am Stadtrand, die Gesamtanzahl der gefahrenen Kilometer sinkt dadurch jedoch nicht zwingend – sie kann sich durch Umwege sogar erhöhen.
Zudem zeigt die Erfahrung: Anlagen ohne Anbindung an den Schienenverkehr werden seltener genutzt. Park+Rail-Modelle – also der Umstieg vom Auto auf die Bahn – sind gerade zu Stoßzeiten deutlich attraktiver, weil sie Geschwindigkeitsvorteile gegenüber dem Straßenverkehr bieten. Reine Busverbindungen haben diese Wirkung kaum.
Auch die Ausstattung vieler P+R-Anlagen lässt zu wünschen übrig: Sie sind oft unbewacht, nur mäßig gepflegt und kaum barrierefrei. Spezielle Stellplätze für Frauen oder mobilitätseingeschränkte Menschen sind selten, die zunehmende Fahrzeugbreite erschwert das Ein- und Aussteigen zusätzlich. Ein weiteres Problem: Mit dem Ausbau von P+R sinkt oft die Auslastung innerstädtischer Parkhäuser – was wirtschaftliche Einbußen für deren Betreiber zur Folge hat.
Statt ausschließlich auf neue P+R-Anlagen zu setzen, könnte ein durchdachtes Parkleitsystem in Kombination mit einem gut getakteten Stadtbusnetz – idealerweise auf eigenen Spuren – ein nachhaltigerer Ansatz sein.
P+R kann ein sinnvoller Baustein in einer modernen Mobilitätsstrategie sein – wenn Planung, Ausstattung und Anbindung stimmen. Wichtig ist die Umsetzung des Gesamtkonzepts.