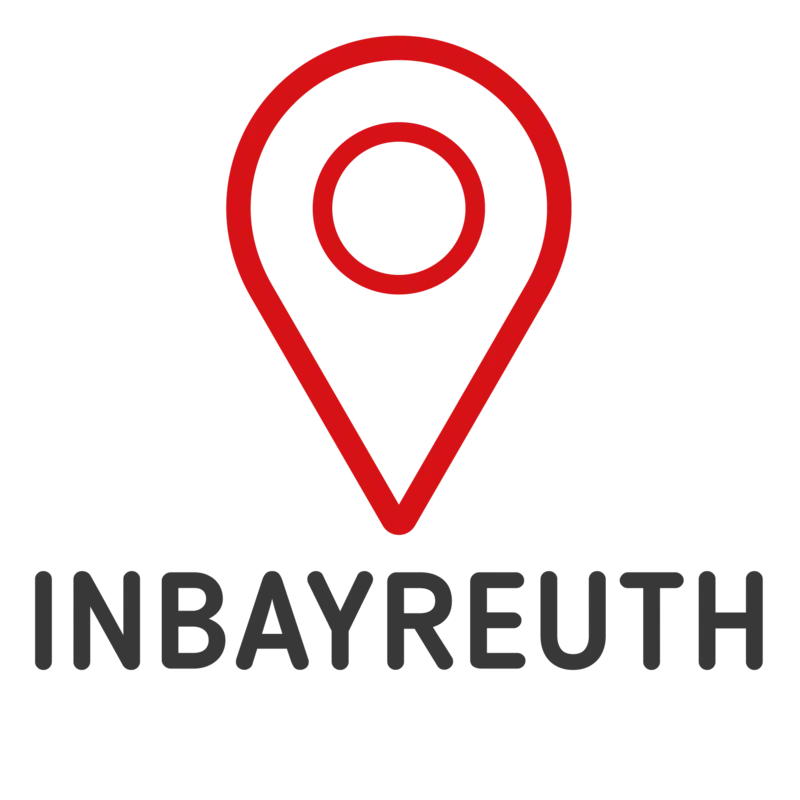Schwefel macht Kunststoff nachhaltiger
Ein Forschungsteam der Universität Bayreuth hat eine Methode entwickelt, um Kunststoffe nachhaltiger zu machen – mithilfe von Schwefel, einem Abfallprodukt der Erdölraffination. Die Wissenschaftler berichten darüber im Fachjournal Angewandte Chemie.
Im Fokus steht sogenannter elementarer Schwefel. Er enthält chemische Bindungen, die sich leicht lösen und wiederherstellen lassen. Solche „dynamischen Bindungen“ sind entscheidend für nachhaltige Materialien. Sie ermöglichen Reparaturen und Anpassungen, ohne dass der Kunststoff zerstört werden muss.
Die Herausforderung: Diese Schwefelbindungen ließen sich bisher nur schwer in Polyester einbauen – eine Kunstoffklasse, die etwa in PET-Flaschen oder Textilien verwendet wird. Das Team um Prof. Dr. Alex Plajer hat nun eine Lösung gefunden.
Die Methode nutzt neben Schwefel auch Epoxide, eine chemische Stoffklasse, die in der Industrie weit verbreitet ist. Viele Epoxid-Arten eignen sich – sogar solche aus natürlichen Rohstoffen. So lassen sich die Eigenschaften des neuen Kunststoffs gezielt steuern: etwa seine Härte oder sein Verhalten bei verschiedenen Temperaturen.
Ein einfacher Katalysator reicht für die Herstellung aus: Lithiumalkoholat. Er ist leicht verfügbar, gut handhabbar und spart Energie, da er unter milden Bedingungen wirkt.
Eine weitere Besonderheit entdeckte das Team beim Reaktionsmechanismus: Der Schwefel selbst – genauer gesagt der sogenannte S8-Ring – beschleunigt die chemische Reaktion. Teile des entstehenden Kunststoffs helfen dabei sogar mit. Ein ungewöhnlicher Effekt, wie Plajer betont.
Die neuen Polyester lassen sich nach der Herstellung weiter verarbeiten. Sie können beispielsweise zu Klebstoffen vernetzt werden, die wiederverwendbar sind und sich bei Hitze oder durch Säure leicht lösen lassen.
Das Projekt wurde vom Verband der chemischen Industrie, der Daimler und Benz Stiftung sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
Der Hintergrund: Polyester gelten als vergleichsweise nachhaltige Kunststoffe. Doch beim Recycling verlieren sie oft an Qualität. Die neue Methode könnte das ändern – und so einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.