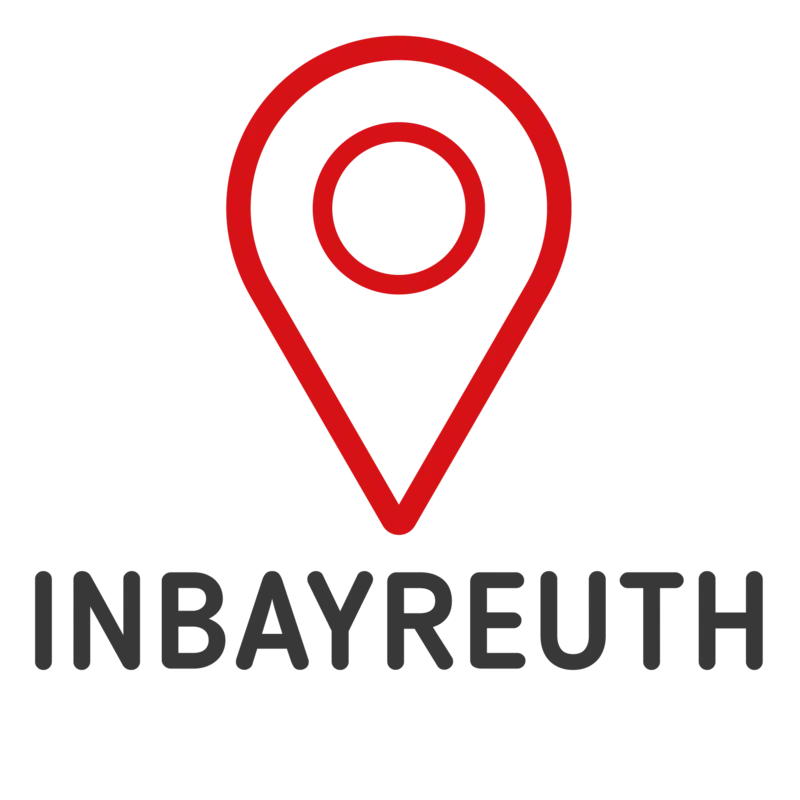Projektstart für nachhaltige Kreislaufwirtschaft
Im Januar startete das von der EU geförderte Projekt BioFairNet, an dem auch die Universität Bayreuth beteiligt ist. BioFairNet basiert auf dem Konzept der Bio-Kreislaufwirtschaft, das technologische Innovationen mit sozialer Gerechtigkeit verbinden soll, um die Wirtschaft ökologischer und nachhaltiger zu gestalten. Insgesamt sind 13 internationale Forschungseinrichtungen an dem Projekt beteiligt.
Das Ziel von BioFairNet ist es, Regionen und Wertschöpfungsketten, die stark von treibhausgasintensiven Industrien wie Landwirtschaft und Bergbau abhängig sind, zu Vorreitern einer nachhaltigen Bio-Kreislaufwirtschaft zu machen. Hierfür soll in dem von der EU mit insgesamt 4,67 Millionen Euro geförderten HORIZON-Forschungsprojekt ein digitales kooperatives Netzwerk aufgebaut werden. Dieses Netzwerk dient als digitale Plattform für das Engagement von Stakeholdern und ermöglicht den Austausch von Informationen und Wissen. Es unterstützt zudem den ökologischen Übergang.
Der Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD der Universität Bayreuth ist neben zwölf weiteren internationalen Forschungseinrichtungen an dem Projekt beteiligt. Dr.-Ing. Tobias Rosnitschek, Akademischer Rat des Lehrstuhls, leitet im Projekt BioFairNet das Arbeitspaket „Green Information Factory for a green and just transition“, das für die Entwicklung datengetriebener Methoden zur Bewertung der entstehenden Bio-Kreislaufwirtschaft-Ansätze verantwortlich ist. Für diese Aufgabe fließen etwa 400.000 Euro aus dem Fördertopf an die Universität Bayreuth.
Das Projekt nutzt eine interdisziplinäre Methodik und bezieht verschiedene Sozialwissenschaften ein. Die digitale Plattform, das Endprodukt des Forschungsprojekts, wird in Zusammenarbeit mit den Hauptbeteiligten bzw. Endnutzern erstellt, um die Lücke zwischen Fachleuten, öffentlicher Verwaltung, Unternehmen und anderen Interessenvertretern im Bereich der Bio-Kreislaufwirtschaft zu schließen.
Das Projekt hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird vom Finanzierungsprogramm „Horizon“ für Forschung und Innovation der EU gefördert. Koordiniert wird das Forschungsprojekt von der Universität Neapel Federico II; weitere beteiligte Forschungseinrichtungen befinden sich in Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada, Kenia und Spanien.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://cordis.europa.eu/project/id/101181568.