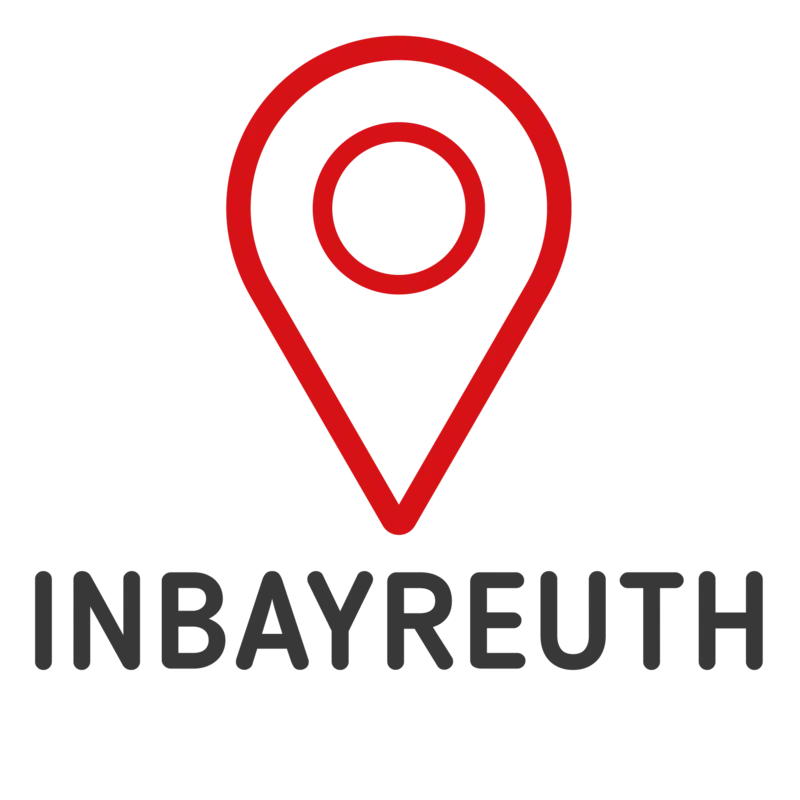Hohe Pflegekosten können zum Anspruch
auf Elternunterhalt führen
BAYREUTH.Die demografische Entwicklung in Deutschland hat zur Folge, dass die Menschen immer älter werden und bedingt dadurch hohe Pflegekosten entstehen können. Aufgrund der Höhe der für eine Pflege, gerade im Falle einer vollstationären Betreuung, anfallenden Kosten, reichen die Rente, das Pflegegeld und der Einsatz eines vorhandenen Vermögens oftmals nicht aus, um die anfallenden Pflegekosten bis zum Lebensende zu decken. In solchen Fällen springt zunächst der Sozialleistungsträger ein und übernimmt die Kosten der Pflege Dieser prüft anschließend, ob die Kinder des jeweiligen Elternteils zu Unterhaltszahlungen herangezogen werden können.
Zunächst werden die Kinder aufgefordert, Auskunft über ihr Einkommen und Vermögen zu erteilen. Die Auskunft muss erteilt werden, und zwar unabhängig davon, ob sich nach Durchführung einer Unterhaltsberechnung eine Unterhaltsverpflichtung ergibt. Es macht also keinen Sinn, die Auskunft zu verweigern, da in diesem Fall die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens nur zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs droht. Es würden also unnötige Prozesskosten anfallen.
Im Zusammenhang mit der Unterhaltsverpflichtung spielt das seit 10.12.2019 bestehende Angehörigenentlastungsgesetz eine Rolle. Durch dieses Gesetz wurde der Übergang des Anspruchs auf Elternunterhalt auf den Träger der Sozialhilfe grundlegend neu geregelt. Dieser findet nur noch dann statt, wenn das gesamte Einkommen des unterhaltspflichtigen Kindes die Jahresobergrenze von 100.000 Euro brutto übersteigt, § 91 Abs. 1a SGB XII in Verbindung mit § 16 SGB IV. Hierbei handelt es sich um eine starre Grenze. Liegt das Bruttoeinkommen bei 100.001,00 Euro, besteht eine Unterhaltsverpflichtung. Liegt das Einkommen unter diesem Betrag, scheidet eine Unterhaltsverpflichtung automatisch aus, und zwar unabhängig von der Höhe des vorhandenen Vermögens des unterhaltspflichtigen Kindes.
Besteht dem Grunde nach wegen des Überschreitens der Einkommensgrenze eine Unterhaltsverpflichtung, muss das vorhandene Einkommen nur bedingt für den Unterhalt der Mutter/des Vaters eingesetzt werden.
Es ist zunächst einmal das sogenannte bereinigte unterhaltsrechtliche Einkommen zu bilden. Um dieses zu ermitteln, können vom Nettoeinkommen verschiedene monatliche Ausgaben in Abzug gebracht werden. Nicht alle Ausgaben sind unterhaltsrechtlich abzugsfähig. Aus diesem Grund sollte eine etwaige Berechnung durch den Sozialleistungsträger immer anwaltlich dahingehend geprüft werden, ob alle Ausgaben zutreffend berücksichtigt wurden. Abzugsfähig sind beispielsweise Kosten für die eigene Altersvorsorge. Beim Elternunterhalt ist grundsätzlich eine (tatsächlich betriebene) Gesamtaltersvorsorge von insgesamt 25 % des Bruttoeinkommens abzugsfähig. Vorausgesetzt, es kann angenommen werden, dass dieses Geld dem Unterhaltspflichtigen im Alter auch tatsächlich zur Verfügung steht.
Dem unterhaltsverpflichteten Kind muss außerdem ein sogenannter Selbstbehalt verbleiben. Nur das über diesen Selbstbehalt hinausgehende bereinigte Einkommen ist für den Elternunterhalt einzusetzen und es sind entsprechende Zahlungen an den Sozialleistungsträger zu erbringen, falls dieser die ungedeckten Pflegekosten zunächst übernommen hatte. Beim Elternunterhalt ist der Selbstbehalt um einiges höher als beim Kindesunterhalt. Die Rechtsprechung akzeptiert zwischenzeitlich einen Selbstbehalt von 5.500 Euro pauschal.